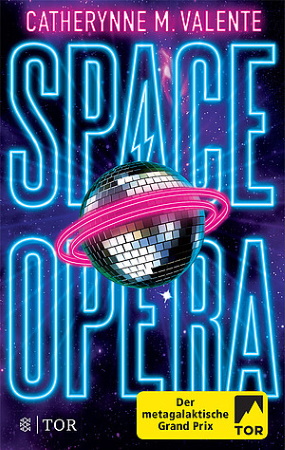 Wenn ein Buch damit angepriesen wird, „Der lustigste Science-Fiction Roman seit Per Anhalter durch die Galaxis“ zu sein, weckt das natürlich gewisse Erwartungen. Schließlich hat das Werk von Douglas Adams nicht umsonst Kultstatus erreicht und viele haben sich schon daran die Zähne ausgebissen, auch nur ansatzweise in dessen Nähe zu kommen. Doch genau das soll laut The Verge Catherynne M. Valente mit ihrem neuesten Roman Space Opera – Der metagalaktische Grand Prix gelungen sein. Ich für meinen Teil bin da etwas anderer Meinung ... Wenn ein Buch damit angepriesen wird, „Der lustigste Science-Fiction Roman seit Per Anhalter durch die Galaxis“ zu sein, weckt das natürlich gewisse Erwartungen. Schließlich hat das Werk von Douglas Adams nicht umsonst Kultstatus erreicht und viele haben sich schon daran die Zähne ausgebissen, auch nur ansatzweise in dessen Nähe zu kommen. Doch genau das soll laut The Verge Catherynne M. Valente mit ihrem neuesten Roman Space Opera – Der metagalaktische Grand Prix gelungen sein. Ich für meinen Teil bin da etwas anderer Meinung ...
Dabei ist die Grundidee wirklich eine tolle: Man nehme den Eurovision Song Contest, also jenen Musikwettbewerb, der Jahr für Jahr Millionen von Europäern (und Australiern) einen ganzen Abend und die halbe Nacht vor den Fernseher bannt, nur um ihnen die schrägsten und/oder kitschigsten Musikdarbietungen näherzubringen, und mache daraus einen metagalaktischen Musikwettbewerb, bei dem es um Freude, aber auch um das Überleben einer ganzen Spezies geht – denn die letztplatzierte Spezies wird kurzerhand vernichtet.
Die Grundidee ist wirklich einzigartig und Catherynne M. Valente schafft es auch auf tolle Art und Weise, den Spaß, den Glamour und dieses Abgedrehte, das bei jedem ESC eine große Rolle spielt, in ihrer Geschichte rüberzubringen, wobei der echte ESC im Vergleich zu dem, was sich die Autorin hat einfallen lassen, beinahe normal wirkt. Valente toppt das alles nämlich nochmal um gleich mehrere Stufen. Hier ist alles noch abgedrehter, noch glamouröser und noch verrückter. Dazu zählen auch die Protagonisten. Sei es der gemischt-rassige, omnisexuelle Hauptprotagonist Decibel Jones oder sämtliche anderen Spezies – sie alle entstammen ganz offensichtlich einer sehr ausgeprägten Fantasie.
Wenn alles so unterhaltsam ist, wieso gehe ich mit der Kritik von The Verge dann nicht konform? Das liegt zuallererst an der Handlung. Die ist in meinen Augen nämlich so gut wie gar nicht vorhanden. Es wird zwar viel geschrieben, aber um die eigentliche Geschichte dreht sich dabei nur herzlich wenig. Stattdessen schweift die Autorin sehr oft sehr weit ab. Anstatt die Geschichte voranzutreiben, erläutert Valente alles haarklein. Vor allem bei den Aliens fällt dies massiv auf. Hier passiert es nicht selten, dass sie es so weit auf die Spitze treibt, dass einzelne Sätze so verschachtelt sind, dass sie sich über sechs, sieben oder gar noch mehr Zeilen hinweg erstrecken. Manchmal bekommt man dabei so viele Informationen entgegen geworfen, dass man gar nicht alles verarbeiten kann und den Satz oder Absatz noch einmal von vorne lesen muss, um am Ende noch zu wissen, worum es eigentlich ging. Dass ein/e Autor*in ihre Bilder, die er/sie im Kopf hat, erläutert, ist vollkommen in Ordnung und natürlich auch gewollt, doch hier ist es doch einfach zu viel des Guten. Hier hätte die Würze tatsächlich in der Kürze gelegen.
Leider ist dies aber nicht das einzige Problem, das ich mit dem Buch hatte. Hinzu kommt nämlich auch noch der generelle Schreibstil. Dieser ist im Grunde sehr einfach gehalten. Ab und an mixt Valente dann aber doch immer wieder ein Wort hinein, das man erst einmal googlen muss, um dessen Bedeutung zu erfahren. Selbst wenn man weiß, was die Wörter bedeuten, wirken sie meiner Meinung nach fehl am Platz und stören den Lesefluss. Ob dieses Problem auch in der englischen Originalfassung auftritt oder einfach nur unglücklich übersetzt wurde, kann ich mangels Exemplar leider nicht sagen.
Leseprobe
1 - BOOM BANG-A-BANG
Auf einem kleinen, wasserreichen, leicht erregbaren Planeten namens Erde, in einem kleinen, wasserreichen, leicht erregbaren Land namens Italien lebte einmal ein sanftmütiger, recht gutaussehender Gentleman namens Enrico Fermi, der in eine so überbehütende Familie hineingeboren worden war, dass er sich bemüßigt sah, die Atombombe zu erfinden. Fermi widmete sich der Entdeckung verschiedener, bisher als äußerst ungesellig verschriener Teilchen wie dem Plutonium, da er ganz unten in der atomaren Pralinenschachtel die leckersten Happen vermutete. Nebenbei fand er die Zeit, über etwas nachzudenken, was als das Fermi-Paradoxon in die Geschichte einging. Für den Fall, dass ihr diesem Gedankenspiel hier zum ersten Mal begegnet, sei es kurz erklärt: Wenn wir einmal davon ausgehen, dass es in der Galaxis Milliarden von Sternen gibt, die unserer guten alten, vertrauten und jeden Tag ihren Dienst tuenden Sonne gleichen, und dass einige davon ein paar Runden mehr gedreht haben als die große gelbe Lady und dass ein paar dieser Sterne Planeten haben, die unserem guten alten, vertrauten Wasserloch Erde gleichen, und dass, wenn auf diesen Planeten Leben möglich sein sollte, höchstwahrscheinlich irgendwann auch welches entsteht – dann müsste da draußen doch schon irgendjemand interstellare Reisemöglichkeiten erfunden haben, und das wiederum legt nahe, dass es, selbst wenn man diese Reisen mit der schnarchlangsamen Raketenantriebskraft aus den 1940er Jahren anträte, nur ein paar Millionen Jahre dauern dürfte, bis die ganze Milchstraße von den unterschiedlichsten Lebensformen besiedelt ist.
Also, wo sind sie denn alle?
Auf diese Frage, die Signore Fermi in seiner transgalaktischen Einsamkeit sehnsüchtig in den weiten Raum hinausrief, überlegte man sich verschiedene Antworten. Zu den beliebtesten gehört die Rare-Earth-Hypothese, die freundlich flüstert: Ganz ruhig, kleiner Enrico. Organisches Leben ist so komplex, dass selbst die einfachsten Algen ein unüberschaubares Maß an spezifischen Bedingungen benötigen, um sich auch nur zur simpelsten Ursuppe zusammenzufinden. Es geht nicht nur um planetare Gesteinsbrocken für Mineralienfans. Man braucht außerdem eine Magnetosphäre, einen Mond (aber nicht zu viele), ein paar Gasriesen zur Schwerkraftkontrolle, ein paar Van-Allen-Gürtel, eine ordentliche Portion Meteore und Gletscher und Plattentektonik – und selbst dann hat man ja noch nicht mal eine Atmosphäre oder Stickstoff im Boden oder ein, zwei, drei Ozeane. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich jedes einzelne der vielen Trilliarden Ereignisse, die auf der Erde zur Entstehung von Leben geführt haben, woanders noch einmal genauso vollzieht. Es war alles nur ein glücklicher Zufall, Schätzchen. Nenn es Schicksal, falls du romantisch veranlagt bist. Oder Glück. Oder Gott. Genieße den Kaffee in Italien, die Würstchen in Chicago und das ausgetrocknete Schinkensandwich im Los Alamos National Laboratory, denn besser wird es nicht. Mehr haben wir als hochentwickelte Luxuslebensform nicht zu erwarten.
Die Rare-Earth-Hypothese ist zwar gutgemeint, aber sie ist leider fürchterlich, spektakulär, haarsträubend falsch.
Das Leben ist nicht selten, es ist auch nicht wählerisch oder einzigartig, und Schicksal hat mit der ganzen Chose schon mal gar nichts zu tun. Um unser kleines, organisches Mini-Gokart in Bewegung zu bringen, reicht es, es einfach einen Abhang hinunterzuschubsen und dabei zuzusehen, wie der Motor anspringt. Das Leben will passieren. Es erträgt es gar nicht, nicht zu passieren. Die Evolution steht überall in den Startlöchern und hüpft von einem Bein aufs andere wie ein Kind in der Warteschlange vor der Achterbahn, das sich so doll auf die bunten Lichter, die laute Musik und die Loopings freut, dass es sich beinahe in die Hosen pinkelt. Und das Beste: Die Fahrt ist fast umsonst. Bewohnbare Planeten, freie Auswahl zum kleinen Preis! Und zu jeder Weltkugel kriegst du noch Flora und Fauna obendrauf! Sauerstoff! Kohlenstoff! Wasser! Stickstoff! Superpreise, alles muss raus! Greift zu!
Die intelligenten Spezies erscheinen dann quasi über Nacht, haben ruckzuck eine industrielle Zivilisation entwickelt und reiten so lange die Ultra-Zyklon-Krake, bis sie sich entweder totgekotzt haben oder Fluchtgeschwindigkeit erreichen und in ihren kleinen, bemalten Plastiksesseln hinaus in die unendlichen Weiten des Weltalls segeln.
Und wenn es erst mal so weit ist, heißt es: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Fazit:
Die Grundidee, den Eurovision Song Contest zu einem metagalaktischen Wettbewerb zu machen und dabei auch noch das Leben einer ganzen Spezies aufs Spiel zu setzen, ist wirklich erfrischend. Auch der Humor, den Valente hier an den Tag legt, ist sehr unterhaltsam – wobei sie kein Klischee des ESC auslässt. Dennoch bin ich von Space Opera nur so mittel begeistert, denn dem gegenüber stehen eine kaum vorhandene und vor allem kaum vorangetriebene Story und ein Schreibstil, den man mögen muss. Ich empfehle daher, eventuell zunächst einmal die Leseprobe zu lesen (von der es z. B. hier eine ausführlichere gibt). Wenn einem das, was man dort zu lesen bekommt, gefällt, kann man ja immer noch zugreifen.
Zu erwerben gibt es Space Oepra - Der metagalktische Grand Prix für 14,99 € (bzw. 12,99 € als e-Book) bei Amazon, direkt beim FISCHER Tor Verlag oder im Buchhandel.
Copyright: © 2019 FISCHER Tor Verlag |
















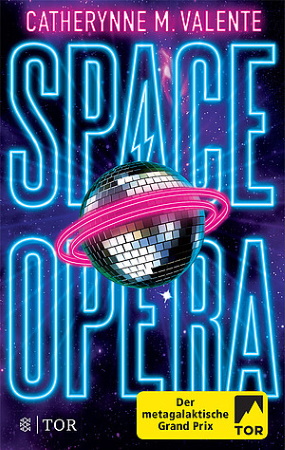 Wenn ein Buch damit angepriesen wird, „Der lustigste Science-Fiction Roman seit Per Anhalter durch die Galaxis“ zu sein, weckt das natürlich gewisse Erwartungen. Schließlich hat das Werk von Douglas Adams nicht umsonst Kultstatus erreicht und viele haben sich schon daran die Zähne ausgebissen, auch nur ansatzweise in dessen Nähe zu kommen. Doch genau das soll laut The Verge Catherynne M. Valente mit ihrem neuesten Roman Space Opera – Der metagalaktische Grand Prix gelungen sein. Ich für meinen Teil bin da etwas anderer Meinung ...
Wenn ein Buch damit angepriesen wird, „Der lustigste Science-Fiction Roman seit Per Anhalter durch die Galaxis“ zu sein, weckt das natürlich gewisse Erwartungen. Schließlich hat das Werk von Douglas Adams nicht umsonst Kultstatus erreicht und viele haben sich schon daran die Zähne ausgebissen, auch nur ansatzweise in dessen Nähe zu kommen. Doch genau das soll laut The Verge Catherynne M. Valente mit ihrem neuesten Roman Space Opera – Der metagalaktische Grand Prix gelungen sein. Ich für meinen Teil bin da etwas anderer Meinung ...